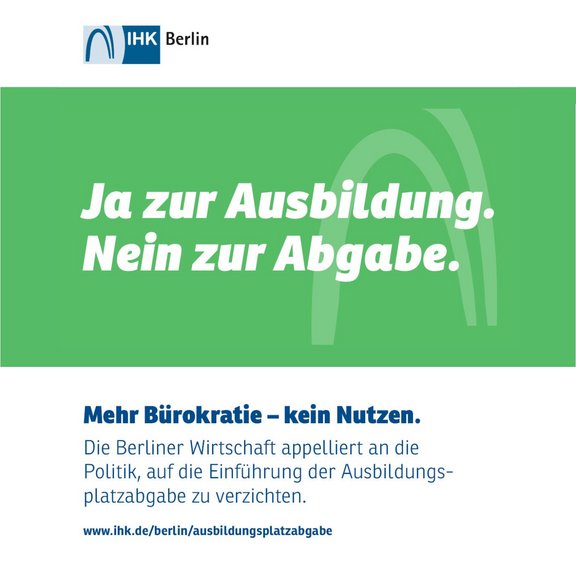Cyberkriminalität
Mittelständische Unternehmen: „Cyberangriffe auf Kunden erleben wir jeden Tag“
Mit der Deutschen Cyber-Sicherheitsorganisation registriert Andreas Rohr mitunter Millionen Attacken aus dem Netz. Immer häufiger hilft er auch Mittelständlern bei der Abwehr.